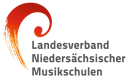<< Themenliste
Essay: Die Zerstörung kultureller Substanz: Eine kritische Analyse der Krise der Musikschule Wesermarsch
Von Thomas SchröderDie Verwaltung des Kulturellen: Eine Dialektik der Zerstörung
Die Musikschule Wesermarsch steht im Zentrum einer bürokratischen Offensive, die unter dem Deckmantel der Haushaltsdisziplin und organisatorischen Rationalisierung die Substanz einer Institution zu zerschlagen droht, die nicht nur musikalische Fertigkeiten vermittelt, sondern als Ort der ästhetischen Erfahrung die Möglichkeit einer emanzipatorischen Subjektivität birgt. Die Kreispolitik und -verwaltung, in ihrem Bestreben, die musikalische Bildung unter das Dach der Kreisvolkshochschule (KVHS) zu zwingen, offenbaren eine Logik, die nicht die Förderung kultureller Praxis, sondern deren Vereinnahmung und Neutralisierung anstrebt. Die KVHS, bar jeder Expertise in der musikalischen Pädagogik, wird als scheinbar neutrale Organisationsform präsentiert, die jedoch nichts weiter ist als ein bürokratisches Gefäß, das die lebendige Praxis der Musikschule in eine leere Hülle verwandeln soll. Hier zeigt sich die Dialektik der Aufklärung: Was als Rationalisierung und Fortschritt verkauft wird, entpuppt sich als Regression, als Zerstörung einer Struktur, die durch ihre Autonomie und ihre Verwurzelung in der Praxis ihre Legitimation findet.
Die vorgebrachte Kritik der Kreisverwaltung, die Schülerzahlen seien auf unter 700 gesunken und die Personalkosten hätten sich verdoppelt, ist nicht nur empirisch fragwürdig, sondern verrät eine Reduktion des Kulturellen auf quantifizierbare Größen. Schülerzahlen schwanken, wie jede Musikschule weiß, in Zyklen, und die angebliche Halbierung ignoriert die Stabilität von etwa 1.000 Schülern selbst während der Corona-Pandemie. Die Behauptung verdoppelter Personalkosten ist eine grobe Verzerrung, da die Musikschule durch verantwortungsvolles Wirtschaften Rücklagen geschaffen hatte, die durch das schließlich inadäquate Förderverhalten des Landkreises aufgezehrt wurden. Solche Verzerrungen sind kein bloßer Irrtum, sondern Ausdruck einer Ideologie, die das Qualitative – die pädagogische Substanz, die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern – dem quantitativen Kalkül unterwirft. Die Verwaltung spricht von Steuergeldverantwortung, doch ihre Rhetorik verschleiert, dass die Haushaltskrise des Landkreises weniger durch die Musikschule als durch eine fehlende vorausschauende Planung verursacht wurde. Eine Zuschusserhöhung von 150.000 Euro für 2024 wurde beschlossen, ohne dass ein tragfähiges Konzept für die langfristige Finanzierung existierte – ein Widerspruch, der die Inkonsistenz bürokratischen Handelns entlarvt.
Die Sprache der Macht: Kommunikation als Herrschaftsinstrument
Die Kommunikation zwischen Musikschule und Kreisverwaltung offenbart eine weitere Dimension der Entfremdung: die Sprache, die eigentlich Medium des Verstehens sein sollte, wird zum Instrument der Macht. Schriftliche Absprachen von Seiten des Landkreises waren selten und vage, der Schulleiter der Musikschule wurde systematisch marginalisiert, nachdem er kritische, aber sachliche Einwände vorbrachte. Diese Ausgrenzung ist nicht bloß ein organisatorisches Versagen, sondern ein Akt der Disziplinierung, der die kritische Stimme zum Schweigen bringen soll. Besonders eklatant ist die Behauptung eines Mitglieds der Gesellschafterversammlung der KVHS, die Musikschule habe nie ein Konzept vorgelegt – eine Aussage, die durch Presseartikel und Zeugen widerlegt wird. Hier zeigt sich die Pervertierung der Sprache: Sie dient nicht der Wahrheit, sondern der Legitimation einer vorgefassten Entscheidung. Die Musikschule legte ein durchdachtes Fusionskonzept vor, das pädagogische Qualität und organisatorische Nachhaltigkeit vereinte, doch es wurde ignoriert, nicht diskutiert, nicht geprüft. Stattdessen wird ein „Musikbereich“ innerhalb der KVHS angekündigt, der inhaltlich nur sporadisch gefüllt wurde – ein Phantom, das die Illusion von Kontinuität erzeugen soll, während es die Substanz zerstört.
Diese Verweigerung des Dialogs ist kein Einzelfall, sondern Ausdruck einer bürokratischen Rationalität, die Kooperation als Bedrohung empfindet. Die Musikschule, die sich durch ihre Autonomie und ihre Haltung auszeichnet, wird als „unbequem“ wahrgenommen. Ihre Weigerung, sich den Vorgaben der Verwaltung zu unterwerfen, wird als Provokation interpretiert, die mit Macht gebrochen werden muss. Die Aufforderung an Eltern, ihre Kinder direkt zur KVHS zu schicken, ist ein Versuch, die Gemeinschaft der Musikschule zu zersplittern und die Beziehung zwischen Pädagogen und Schülern zu instrumentalisieren. Es ist ein Akt der Vereinnahmung, der die Subjektivität der Beteiligten negiert und sie zu bloßen Objekten bürokratischer Planung degradiert. Die Politik schafft sich dadurch ihre eigenen Monster und wundert sich tatsächlich über eine sich zunehmend radikalisierende Gesellschaft.
Die Zerstörung des Ästhetischen: Ein Angriff auf die Subjektbildung
Die musikalische Bildung, wie sie die Musikschule Wesermarsch verkörpert, ist mehr als die Vermittlung technischer Fertigkeiten. Sie ist ein Raum, in dem Subjekte sich durch ästhetische Erfahrung entfalten, in dem die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern, zwischen Klang und Ausdruck, eine Form von Freiheit ermöglicht, die in der verwalteten Welt zunehmend verloren geht. Die geplante Überführung unter das Dach der KVHS droht diesen Raum zu schließen. Die KVHS, die keine Erfahrung in der musikalischen Pädagogik hat, kann die spezifische Qualität der Musikschule nicht ersetzen. Ihr Bereich „Musik und Kultur“ ist eine bürokratische Fiktion, die die Form bewahrt, aber den Inhalt auslöscht. Was bleibt, ist ein verwalteter Schein, der die Illusion von Kultur aufrechterhält, während die Substanz verloren geht.
Die Lehrkräfte der Musikschule, die sich anonym zu diesem Konflikt äußern, sprechen von „geklauter Zeit“ und „zerstörter Substanz“. Ihre Wut ist berechtigt, denn sie richtet sich gegen eine Verwaltung, die nicht nur Strukturen, sondern das Vertrauen in öffentliche Verantwortung beschädigt. Die Musikschule hat sich durch Corona behauptet, ohne nennenswerte Verluste, und dennoch wird ihre Leistung kleingerechnet. Zahlen werden verzerrt, Stundenzahlen falsch dargestellt, und die pädagogische Arbeit wird systematisch entwertet. Dies ist kein bloßes Missverständnis, sondern ein Angriff auf eine Institution, die sich durch ihre Haltung und ihre Autonomie auszeichnet.
Der Widerstand des Partikularen
Die Krise der Musikschule Wesermarsch ist ein Mikrokosmos der Widersprüche der verwalteten Gesellschaft. Sie zeigt, wie die bürokratische Rationalität, die vorgibt, das Gemeinwohl zu sichern, in Wahrheit das Partikulare – die konkrete Praxis, die lebendige Gemeinschaft – zerstört. Die Musikschule ist nicht nur eine Institution, sondern ein Raum des Widerstands gegen die Vereinnahmung durch eine Logik, die alles dem Kalkül unterwirft. Ihre Lehrkräfte und Schüler verkörpern eine Praxis, die sich nicht in Zahlen fassen lässt, die sich der bürokratischen Kontrolle entzieht.
Die Eltern sind aufgerufen, diesen Widerstand zu unterstützen, indem sie den Kontakt zu ihren Lehrkräften halten und sich nicht von den Verlockungen einer scheinbar geordneten Lösung täuschen lassen. Die Zukunft der musikalischen Bildung liegt nicht in der KVHS, sondern in der Gemeinschaft, die durch Vertrauen, Engagement und ästhetische Praxis zusammengehalten wird. Die Musikschule Wesermarsch ist ein Mahnmal dafür, dass Kultur nicht verwaltet, sondern gelebt werden muss. In ihrer Verteidigung liegt die Möglichkeit, einen Rest an Freiheit zu bewahren – eine Freiheit, die in der Begegnung mit dem Klang, in der Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, in der Haltung gegenüber einer verwalteten Welt besteht.
11.09.2025 11:45
Druckversion